Auf Facebook schrieb mir eine Mutter, in meinem Bericht über unseren Betreuungs-Weg mit unseren drei Kindern fehle ihr eine Reflexion meiner eigenen Privilegien. Diese reiche ich hiermit nach.
Als ich schwanger war mit meinem ersten Kind, waren mein Mann und ich beide 23 Jahre alt und studierten noch. Wir lebten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im sozialen Brennpunkt und auf unser Konto gingen jeden Monat zweimal 580 Euro ein – so hoch war damals der BaföG-Satz. Wir hatten so wenig Geld, dass wir von der Bundesstiftung Mutter und Kind einen Zuschuss zur Erstausstattung bekamen. Das war toll, denn so konnten wir uns ein Tragetuch leisten. Wir hatten kein Auto, kein Kinderzimmer, keinen Studienabschluss, keinen Job.
Und trotzdem waren wir schon zu diesem Zeitpunkt privilegiert: Wir waren beide in Akademiker-Haushalten aufgewachsen, in denen Bildung eine große Rolle spielte. Wir hatten Familien und Freunde, die uns unterstützten. Und auch uns im Germanistikstudium immer wieder gesagt wurde, wir könnten uns schon mal auf ein Leben als Taxifahrer einstellen, vertraute ich den Statistiken, die besagten, dass auch ein geisteswissenschaftlicher Hochschulabschluss irgendwann mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit den Weg zu einem Job ebnen würde, von dem ich leben können würde.
Wir kümmerten uns abwechselnd um unsere Tochter, schlossen beide unser Studium ab, mein Mann begann zu promovieren, wir bekamen unser zweites Kind. Weil ich mittlerweile als Journalistin arbeitete, konnten wir uns nun eine Vier-Zimmer-Wohnung und ein Auto leisten, und später gute Betreuung für unsere Töchter.
Wir zogen nach London, wo das Leben schön und teuer ist, und arbeiteten beide viel und gern, obwohl die erstklassige Kinderbetreuung, die dafür nötig war, ein kleines Vermögen kostete. Wir wollten dieses Leben, die zufriedenen Kinder und den Erfolg im Beruf. Und es war ein großes Privileg, diese Wahl treffen zu können, auch wenn dabei für uns am Ende zum Leben nicht viel mehr Geld übrig blieb als wir damals im Studium hatten.
Mehrere haben mir geschrieben, ihnen habe in meinem letzten Beitrag zum Thema Kleinkindbetreuung eine Reflexion meiner Privilegien gefehlt. Diese sei hiermit nachgereicht. Ich bin eine privilegierte Frau, und ich bin es immer gewesen: weil ich gesund und gut ausgebildet bin, weil ich als Weiße, die unter Weißen lebt, nicht Opfer von Rassismus werde, weil nicht alleinerziehend und nicht arbeitslos bin und noch aus vielen anderen Gründen. Doch das heißt nicht, dass ich nicht weiß, wie man sich fühlt, wenn das Geld kaum bis zum Ende des Monats reicht, und wenn sich die Entscheidung für oder gegen Kleinkind-Betreuung nicht frei anfühlt, weil der finanzielle Druck so hoch ist.
Wenn ich dann also beschreibe, wie ich mich bei meinem dritten Kind in der Betreuungsfrage entschieden habe, dann tue ich dies sicher nicht, ohne mir meiner Privilegien bewusst zu sein. Denn ich weiß: Während der Verzicht auf Betreuung für manche Familien nicht mehr als der Verzicht auf gewisse Annehmlichkeiten heißt, bedeutet er für andere ein Leben am Existenzminimum.
Es macht mich demütig und dankbar, dass für meinen Mann und mich in dieser Frage tatsächlich bei allen unseren drei Kindern nur eines ausschlaggebend war: was sich für uns als Familie richtig anfühlte. Ob als mittellose Studenten, als junge Berufsanfänger oder heute als gut im Berufsleben angekommene 34-Jährige mit drei Kindern – wir hatten immer das Gefühl, die Wahl zu haben, und uns für gute Kinderbetreuung zu entscheiden, weil wir es wollten, nicht weil wir es mussten.
Dieses Gefühl echter Wahlfreiheit wünsche ich allen Eltern. Denn es ist vielleicht das größte Privileg, das ich habe.




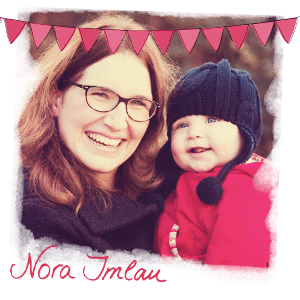

0 Comments on "Privilegien"