Ich war acht, als ich beschloss: Wenn das mit dem unserer Erde noch etwas werden soll, muss ich aktiv werden. Mit dem Gedanken, die Welt zu retten, war es mir ernst: Ich sammelte den Müll aus dem kleinen Wald hinter unserem Haus, verkaufte selbstgemalte Bilder, um den Erlös an die hungernden Kinder in Somalia zu spenden, und aß keinen Thunfisch mehr, der armen Delfine wegen. Schrieben die anderen Kinder in meiner Klasse in blütenweiße Schreibhefte, hatte ich welche aus grauem Recyclingpapier, und meine Schulbücher waren in Papier eingeschlagen statt in schmutzabweisender Plastikfolie. Ich benutzte keinen Tintenkiller und keine Fineliner, und hielt den anderen auf dem Pausenhof engagierte Vorträge darüber, dass ihre kleinen hohes-C-Trinkpäckchen umweltschädlich wären und sie doch besser auf nachhaltige Mehrwegflaschen setzen sollten (was mich nicht unbedingt beliebter machte). Ich trug die abgelegten Klamotten meiner Cousine auf und weigerte mich, in Skiurlaub zu fahren – des ökologischen Raubbaus an den Alpen wegen.
Ich war ein Kind, wie es viele Kinder sind: Interessiert an den Geschehenissen der Welt. Und ganz davon beseelt, das Richtige zu tun. Eine zeitlang fühlte sich das richtig gut an: Ich bin zwar klein, doch ich mache einen Unterschied. Ich bestellte mir die Aufklärungsbroschüren der Kinder von Greenpeace und las umweltbewegte Aufklärungsbücher, die zur Verdeutlichung der Dringlichkeit ihrer umwelt- und gesellschaftspolitischen Themen auch vor krassen Horrorszeniarien nicht zurückschreckten. (Gudrun Pausewang, anyone?)
Je mehr ich las, schlechter ging es mir. Ich hatte das Gefühl: Egal, was ich tue, es ist nie genug. Hier demonstriere ich gegen Ausländerfeindlichkeit, dort wird trotzdem ein Atomkraftwerk gebaut. Ich esse zwar kleine Nutella mehr, wegen der Gorillas. Doch für meinen Schokoladennikolaus wurde vermutlich trotzdem ein Kind auf einer Kakaoplantage ausgebeutet. Als Jugendliche lag ich abends oft noch lange wach und leistete innerlich Abbitte für all meine Nachhaltigkeitssünden: Der Hollywood-Blockbuster, den ich mit Freundinnen im Kino gesehen hatte – hatte sicher eine schauerliche CO2-Bilanz. Der Flug zum Schulaustausch nach Wales – würde ich diese ökologische Schuld je wieder abtragen können? Ich hatte das Gefühl: Die Erwachsenen tun so wenig, sie regen sich sogar über die „5 Mark pro Liter Benzin“-Forderung der Grünen auf, als ginge es ihnen an den Kragen – da muss ich noch mehr tun, um dieses kollektive Versagen auszugleichen.
Als junge Erwachsene gab es dann eine Zeit, da ging es mir mit dem Thema Nachhaltigkeit wieder sehr gut. Ich war Studentin, hatte viel Zeit, um mich mit meinen eigenen Werten und Idealen zu beschäftigen, und lebte in einer Stadt, in der es einfach war, mit relativ wenig Geld ziemlich ökologisch korrekt zu leben. Ich war stolz darauf, ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, nachhaltig im Bio-Laden einzukaufen und erste kleine ökologische Cowdfunding-Projekte zu unterstützen. Ich konnte überhaupt nicht verstehen, warum nicht alle so leben, und blickte mit einer gewissen selbstgefälligen Überheblichkeit auf die herab, die nach der Arbeit bei Aldi vorbeihetzten, offensichtlich ohne jeden Nachhaltigkeitsgedanken im Kopf. Und viele von diesen Menschen hatten sogar Kinder! Das ging mir erst recht nicht in den Kopf. Hat man als Eltern nicht besonders die Verantwortung, Vorbild zu sein?
Heute schäme ich mich für die Selbstgerechtigkeit, mit der ich damals meine Weltrettung durch bewussten Konsum vertrat. Wie wenig Ahnung hatte ich damals von der Lebenswirklichkeit vieler Menschen, wie wenig Bewusstsein für meine eigenen Privilegien! Mein Leben war dann zum Glück so freundlich, mir in den darauffolgenen Jahren an verschiedenen Stellen immer wieder aufzuzeigen, wie viel komplexer die Frage ist, was es heißt, ein guter Mensch zu sein. Ich habe erlebt, was es heißt, so am Existenzminimum zu kratzen, dass ich froh war, wenn es noch für Nudeln mit Tomatensoße von Norma reichte. Und ich habe erfahren, wie es sich anfühlt, so erschöpft zu sein von der alltäglichen Verantwortung als Mutter, dass für Nachhhaltigkeitsgedanken manchmal schlicht keine Kraft mehr bleibt. Ich habe gespürt, wie zerstörerisch Perfektionismus sein kann, auch und gerade in Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen. Wie Beziehungen zerbrechen können am Streit darum, wer nun einen guten Grund hat, ein klimafeindliches Auto zu besitzen und wer einfach nur faul ist. Und wie schlimm es sein kann, als Mutter im Internet Tag für Tag den Eindruck vermittelt zu bekommen: Egal, was du schaffst – andere schaffen es immer noch besser. Und egal was du tust – es wird immer Menschen geben, die dir sagen, es sei nicht genug.
In einer dieser Krisenzeiten – sie ist zum Glück schon wieder eine ganze Weile her – suchte ich mir Rat in einer psychologischen Beratungsstelle. In dem Gespräch ging es eigentlich gar nicht um Ökologie und Nachhaltigkeit, sondern vielmehr um die Frage: Warum schaffe ich es nicht, einfach glücklich zu sein? Doch je länger wir uns unterhielten, desto deutlicher wurde, dass einer der ganz großen Glücks-Hemmer in meinem Leben ein Glaubenssatz war, der direkt aus meiner Umweltretterinnensseele stammte:
Du hast kein Recht, es dir leicht zu machen auf Kosten des Planeten.
Bezogen auf meinen Alltag mit kleinen Kindern hieß das: Ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich Wegwerfwindeln und Feuchttücher benutze. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, als wir einen Kinderwagen kauften. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, als wir ein Auto anschafften. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich alle Einkäufe auf dem Rückweg vom Kindergarten einfach im nächstgelegenen Supermarkt machte statt im weiter entfernten Bioladen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich bei Tschibo im Angebot zwei Paar Matschhosen kaufte, einfach weil ich sie beim Einkaufen da hängen sah und welche brauchte. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich meinen Leinenbeutel vergessen hatte und eine Tüte brauchte. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich es nicht schaffte, vegetarisch oder noch besser vegan zu leben. Und so weiter. Und so weiter.
Es war erschöpfend. Es war ermüdend. Es war ein Kampf, den ich nicht gewinnen konnte. Für mich persönlich war es deshalb eine ganz wichtige Botschaft, in diesem Moment zu hören: Du bist gut, so wie du bist. Und du hast jedes Recht, dir deinen Alltag so leicht zu machen, dass du und deine Familie glücklich leben können. Bevor du gut für die Welt sorgen kannst, musst du erstmal gut für Dich selbst und Deine Kinder sorgen. Das ist jetzt deine Aufgabe.
Heißt das, dass mir heute Nachhaltigkeit und Umweltschutz nicht mehr am Herzen liegen? Nein: Einmal Weltretterin, immer Weltretterin. Aber ich habe gelernt, dass dabei immer und zuallererst freundlich zu mir selbst zu sein, und zu meinen Kindern. Ich gebe mir die Erlaubnis, zu tun, was ich kann – und nicht mehr. In der Folge lebe ich heute so ein mittelökologisches Leben mit meinem Mann und meinen Kindern, ohne Schuldgefühle. Und bin glücklich.
Und deshalb begreife es heute als ein Stück Weltrettung, eben auch diese Botschaft in die Welt zu tragen: Seid zu allererst großzügig und liebevoll mit Euch selbst. Denn ich kenne so viele Menschen, denen es geht, wie es mir ging. Die sich unzureichend fühlen, als Mutter, als Mensch, ständig. Die das Gefühl haben, nie genügen zu können, und nie genug zu tun angesichts des Zustands dieser Welt.
Natürlich können wir jetzt alle kleine, gar nicht aufwändige, ganz billige und alltagsnahe Wege sammeln, mehr Nachhaltigkeit zu leben. Aber ganz ehrlich: Das ist gerade nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist es, den Druck sichtbar zu machen, der auf vielen Familien lastet, und zu sagen: Ihr seid damit nicht allein. Ihr seid gut, so wie Ihr seid. Ihr tut genug.




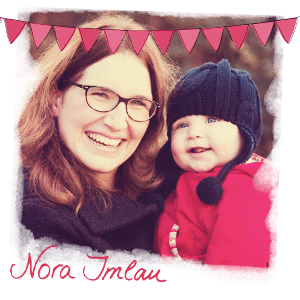

10 Comments on "Wie ich versuchte, die Welt zu retten"
Olga
19/11/2018Danke! Danke dir so sehr für diese Worte.
Tina
20/11/2018Das schlechte Gewissen kenne ich gut...Gerade heute kam es mal wieder hoch, als ich dachte, dass ich wohl die Milch im Tetrapak kaufen muss, weil ich es einfach nicht zur Milchtankstelle schaffe. Aber es gibt ja auch die schönen Momente. wenn man merkt, dass das, was man tut, Kreise zieht. Z.B. wenn ich jemanden gewinnen kann, auch bei den Marktschwärmern einzukaufen. Oder wenn ich Müll sammele auf dem Spaziergang mit dem Kollegen und der am nächsten Tag auch plötzlich mit sammelt. Oder wenn ich einem Bekannten erzähle, dass wir Wasser nur in Glasflaschen kaufen und er für seine ganze Firma jetzt nur noch Glasflaschen kauft. Das sind Hoffnungsschimmer. Aber es wäre toll, wenn auch mal die Regierung endlich sehen würde, dass es fünf vor 12 ist und die kleinen Maßnahmen nicht mehr reichen.
Natascha
20/11/2018Danke! Der Artikel kam gerade richtig! Gerade heute morgen habe ich mich schlecht gefühlt, weil die Mutter neben mir ihre Tupperdosen für die Frischetheke dabei hatte und ich nicht - obwohl ich das schon lange vor habe
Katharina
20/11/2018Danke für den Artikel! Ich habe mich wiedererkannt und sehe nun, dass ich daran arbeiten darf.
Hmm
20/11/2018Sehr wahr.
Ich möchte als Expertin für die Materie noch folgendes hinzufügen: die Art des Konsums ist nicht die größte Stellschraube für Nachhaltigkeit. Weniger Konsum wo immer möglich bewirkt weitaus mehr. Es bringt mehr, sich damit zu beschäftigen wo man verzichten kann anstatt sich in Scheindiskussion zu verlieren. Deswegen leben arme Menschen ja auch unfreiwillig nachhaltig, einfach weil sie gar nicht so viel konsumieren können.
Beliebtes Beispiel: Stoffwindeln sind nicht zwingend ökologischer als Wegwerfwindeln. Je nachdem wie ich die Faktoren gewichte schneiden Stoffwindeln sogar schlechter (!) ab wegen des Wasserverbrauchs und ggf. Stromverbrauchs wenn ein Trockner benutzt wird. An so nette Effekte wie die Belastung des Abwassers durch Schwermetalle wegen des Zinks in Popocremes denkt man als Laie auch nicht unbedingt.
Das macht mich dann immer traurig wenn sich junge Eltern stressen und Arbeit mit den Stoffwindeln machen obwohl es tatsächlich keinen ökologischen Nutzen bietet.
Da macht es in meinen Augen mehr Sinn die Zeit für sinnvollere Dinge aufzuwenden (ich gehe z.B. dann in meiner freien Zeit am Wochenende auf Kleiderbörsen um fürs Kind gebrauchte Sachen zu kaufen oder verbringe die Zeit mit meinem Kind als Wäscheberge zu bewältigen).
Cél
22/11/2018Sehr schöner Beitrag, den ich so nur unterschreiben kann.... der Druck auf Familien ist so gross.... und allem kann man einfach nicht gerecht werden.
Sonja
11/12/2018Danke. Mir fällt es nicht einfach, die Schuldgefühle abzuschalten, aber es hilft zu lesen, wie vielen anderen es ähnlich geht. Und dass auch kleine Dinge eine Wirkung haben.
Nadine
15/12/2018Danke, du sprichst mir aus der Seele!
Hoffentlich brennt sich diese Botschaft in meinen Kopf.
Katharina
20/12/2018Krass, diese Worte sprechen mir aus der Seele. Danke dir!! Es ging bei mir als Kind zwar nicht ganz so weit, denn meine Eltern waren eben die Ökos und irgendwann habe ich mich getraut dagegen etwas anzusteuern ;-). Dennoch steckt das Öko-Gen in mir. Und das ist auch gut so. Aber genau wie du fühle ich mich ständig schlecht, weil ich nicht genug tue. Und streite mich mit meinem Mann, weil er nicht mitziehen will, wenn ich mal wieder eine fixe Idee habe. Zu allem “Übel“ habe ich auch noch Umweltwissenschaften studiert und weiß auch noch aus wissenschaftlicher Sicht, was ich jeden Tag anrichte :D. Dein Text ging gerade runter wie Öl und ich werde das jetzt definitiv beherzigen, denn du hast sooo Recht!!
Gloria
20/08/2019Liebe Nora,
ich danke die von Herzen für diesen Artikel, der mir sehr weitergeholfen hat! <3 Ich komme immer wieder auf ihn zurück, wenn ich mal wieder zu hartherzig mit mir selbst umgehe und durch meine Schuldgefühle (wenn ich es schon wieder nicht schaffe "perfekt" zu leben) auch in dem Moment keine gute Partnerin für meinen Mann bin, sonder mich selbst zermürbe. Da ist deine Sichtweise einfach befreiend und tut so gut - danke! :) Liebe Grüße