Marias Tag hat trotz Mutterschutz eine ziemlich klare Struktur: Aufstehen, duschen, Morgenrunde mit dem Hund. Drei Hauptmahlzeiten und zwei Zwischensnacks. Abends Netflixen und Nachrichten gucken, gegen halb elf geht’s ins Bett.
Auch Tom ist an einen festen Rhythmus gewöhnt: 20 Minuten schlafen, 20 Minuten spielen und turnen, dann wieder 20 Minuten schlafen. Rund um die Uhr. Tom kennt weder den Unterschied zwischen Tag und Nacht noch das Prinzip von Mahlzeiten, die’s nur in einem bestimmten Abstand gibt. Denn Tom wohnt in Marias Bauch
Drei Wochen später stehen beide, Maria und Tom, vor einer riesige Herausforderung: Ihre beiden so völlig unterschiedlichen Rhythmen unter einen Hut zu bekommen. Denn Tom behält nach der Geburt seinen vertrauten 20-Minuten-Rhythmus erstmal bei. Und Maria? Richtet sich natürlich erstmal ganz nach Tom. Stillt ihn, wann immer er mag – und das ist eigentlich jede Stunde. Versucht zu schlafen, wenn das Baby schläft. Und isst irgendwann dazwischen hastig ein paar Bissen, von denen sie nicht sagen könnte, ob sie ein sehr verspätetes Frühstück oder ein enorm verfrühtes Mittagessen sind. Netflixen? Um halb elf ins Bett und schlafen bis zum nächsten Morgen? Vergiss es!
Jeder Entwicklungspsychologe würde Maria applaudieren. Schließlich haben viele Studien gezeigt: Babys entwickeln sich am besten, wenn sie nach Bedarf gestillt werden und die Eltern auch sonst alle Bedürfnisse gleich befriedigen. Die eigenen Wünsche erstmal hinten anzustellen, ist bei frischgebackene Mütter und Väter auch ein ganz normales und natürliches Verhalten: Für ein Baby, das so bedingungslos von einem abhängig ist, verzichtet man erstmal leichten Herzens auf die vertraute Tagesroutine. Auch wenn die unberechenbaren Tage und die ständig unterbrochenen Nächte natürlich schlauchen. Aber jetzt wird’s tricky: So richtig der Impuls ist, einfach alles für dieses Kind tun zu wollen – er birgt auch eine Gefahr: Die Aufopferungs-Falle.
In die tappt zum Beispiel, wer vor lauter Fürsorge vergisst, dem Neugeborenen ganz sanft zu zeigen, wie die Uhren hier ticken .Nämlich nicht im 20-Minuten-Takt, sondern im Tag-Nacht-Rhythmus. Und deshalb jedes Mal, wenn das Baby schläft, das Zimmer verdunkelt und auf Zehenspitzen durchs Haus schleicht. Und beim Wickeln nachts um vier genauso ein Action-Programm hinlegt wie am Nachmittag. Ein Baby sollte nie das Gefühl erleiden müssen, dass sein Weinen ignoriert wird. Aber es darf durchaus merken, dass Mama und Papa nachts müde sind und zum Spielen keine Lust haben. Einem Baby auf diese Weise zu zeigen, dass es nicht besonders attraktiv ist, nachts wach zu sein, ist nicht egoistisch, sondern unterstützt einen wichtigen Entwicklungsschritt: Dadurch lernen Babys, Tag und Nacht voneinander zu unterscheiden.
Der Schlüssel zu einem ersten Rhythmus sind die Signale des Babys: Um seine Bedürfnisse herum lässt sich oft ein erster, einigermaßen verlässlicher Tagesablauf strukturieren.
Wann der Körper diese Information gespeichert hat, können Wissenschaftler sogar nachmessen: Haben Babys anfangs eine immer gleiche Körpertemperatur, steigt sie schon bei sechs Wochen alten Kindern – wie bei uns Erwachsenen – tagsüber leicht an, erreicht abends ihren Höhepunkt und sinkt über Nacht wieder ab. Hat der Körper diesen Rhythmus erstmal intus, ist der Grundstein für aktive Tage und ruhigere Nächte gelegt.
Und den Tag selbst, muss man den auch strukturieren? Zunächst einmal: Müssen muss niemand. Eine Tagesroutine hat keinen Zweck, wenn Eltern sie nur einführen, weil sie in einem schlauen Buch gelesen haben, dass gute Eltern das tun. Wer auch schon vor der Schwangerschaft mehr das kreative Chaos als die strukturierten Stundenpläne liebte und diese Lockerheit glücklich in den Babyalltag hinüberretten konnte: Ruhig so weitermachen und bloß kein schlechtes Gewissen haben! Die meisten Babys sind flexibler als wir denken: Wenn Mama und Papa zufrieden sind, macht es ihnen gar nichts aus, mal um sieben und mal erst um elf ins Bett zu gehen und dann morgens auch dementsprechend länger auszuschlafen. Nur wenn ein Kind sehr quengelig und nervös wirkt und schwer in den Schlaf findet, kann das ein Signal ein: Ein bisschen mehr Berechenbarkeit, bitte! Denn das ist der glasklare Vorteil von Routine: Schon 6 Monate alte Babys können aus sich immer wiederholenden Abläufen ableiten, was kommt: Jetzt lässt Mama das Wasser ein, dann werde ich gebadet, danach geht’s in den Schlafsack. Das Vertraute gibt Sicherheit und Geborgenheit – die gerade bei so genannten „schlechten Schläfern“ Wunder wirken kann.
Wie aber kriegt man eine solche Struktur in den Tag? Am besten, indem man das Baby beobachtet. Und dann eine Routine um seinen natürlichen Rhythmus herumbaut. Denn: Es ist tatsächlich nachgewiesen, dass auch schon Babys eine innere Uhr haben, die individuell verschieden ist – Frühaufsteher und Nachteulen gibt’s auch schon bei den Kleinsten. Wer da auf starre Zeiten beharrt („Ein Kind gehört um sieben ins Bett.“) tut weder sich noch dem Baby einen Gefallen: Zermürbende Kämpfe mit einem Kind, das einfach noch nicht schlafen kann, bedeuten nur unnötigen Stress. Besser: Gucken, zu welchen Tageszeiten das Kind besonders aktiv ist, in welchen Abständen es Hunger hat und wann es am leichtesten einschläft. Der zweite, nicht weniger wichtige Schritt: Sich auch die eigenen Bedürfnisse bewusst machen – eine Stunde Ruhepause am Nachmittag zum Beispiel. Im dritten Schritt geht’s darum, die Schnittmenge herauszufinden: Ihr Kind trinkt meist noch mal ausführlich gegen Mittag und ist danach tendenziell müde, wenn es nicht eine Stunde vorher im Kinderwagen geschlafen hat? Dann ist es durchaus legitim, es in dieser Zeit wach zu halten und eine feste Mittagschlafzeit einzuführen.
Wann Babys von sich aus so einen inneren Rhythmus zeigen und auch eine äußerlich vorgegebene Routine annehmen, ist von Kind zu Kind verschieden. Viele Eltern machen ab dem 4. bis 6. Lebensmonat gute Erfahrungen damit, ihr Baby immer ungefähr zur gleichen Zeit schlafen zu legen. Mit dem Beikoststart ist ein guter Zeitpunkt, regelmäßige Mahlzeiten einzuführen. Die stimmt man wiederum am besten mit den Schlafenszeiten ab: Ausgeschlafene Babys essen besser, und so ist nach dem Vormittagsschlaf ein guter Zeitpunkt fürs Mittagessen. Spiel- und Tobezeit wäre dann am besten morgens gleich nach dem Aufstehen und nachmittags nach dem Essen. Viele Familien fahren außerdem gut damit, zwischen Abendbrei und Ins-Bett-Bringen noch eine ruhige Kuschelzeit einzuplanen, die dem Kind signalisiert: Jetzt ist es Zeit, langsam ruhig zu werden.
Viel wichtiger als feste Uhrzeiten sind für Babys übrigens verlässliche Abläufe: Die immer gleiche Reihenfolge von Schlafanzug anziehen, Lied singen, stillen und schlafen wirkt auch dann beruhigend, wenn sie mal abends um sieben und mal erst um halb neun stattfindet.
Und dann gibt’s noch die Rituale, die dem Baby zwar erstmal herzlich egal, aber trotzdem wichtig sind – weil sie Müttern Kraft zum Weitermachen geben: Jeden Vormittag um 10 wartet die Freundin aus dem Geburtsvorbereitungskurs vorm Haus mit dem Kinderwagen, und man dreht gemeinsam eine Morgenrunde durch die Fußgängerzone. Gönnt sich Coffee to Go und einen Schokomuffin. Oder: Jeden Donnerstagabend zwischen sechs und acht hat Papa Babydienst. Weil da im Fitnessstudio „Aerobic nach der Geburt“ angeboten wird. Und dass das klappt, muss sich das Baby eben auch mal ein bisschen an Mama anpassen. Dann wird es eben um neun geweckt, dass man die wartende Freundin nicht versetzt. Und dann stillt man es eben noch mal kurz vorm Aerobic-Kurs, auch wenn es eigentlich noch keinen richtigen Hunger hat, weil mit voller Brust Turnen keinen Spaß macht.
Der springende Punkt ist also: Zwei völlig unterschiedliche Rhythmen unter einen Hut zu kriegen klappt nur dann gut, wenn sich auf die lange Sicher keiner dem anderen unterordnen muss. Sondern wenn man einen neuen, gemeinsamen Rhythmus findet, der allen gut tut. Es geht eben nicht darum, sich im ersten Lebensjahr voll und ganz den Bedürfnissen des Babys unterzuordnen – weil man sich sonst selbst verliert. Die Folge: Frust und Enttäuschung, und irgendwann das Gefühl: Jetzt ist Schluss. Jetzt will ich wieder die Oberhand haben. Wer an diesem Punkt angelangt ist, hat oft keine Kraft mehr, sanft die Bedürfnisse des Babys an die eigenen anzupassen. Sondern macht einen harten Schnitt: Ab jetzt geht’s um acht ins Bett, egal, wie sehr du schreist.
Dass es so weit nicht kommt, ist wichtig, zu wissen: Elternsein heißt auch im ersten Jahr nicht Aufopferung, sondern eine gesunde Balance aus Geben und Nehmen. Am besten geht es den Familien, denen es den Eltern gelingt, von der Vorstellung der Fremdbestimmtheit wegzukommen und sich stattdessen darauf einzulassen, dass das Leben mit Baby ein nicht exakt durchzuplanendes Abenteuer ist. Die die Struktur genießen, die sich allmählich von selbst etabliert. Und sich trotzdem auch so ins Spiel vertiefen können, dass sie gemeinsam mit ihrem Baby mal alle Zeit und allen Rhythmus vergessen.
Dieser Text erschien erstmals 2008 in der Zeitschrift ELTERN.
Foto: Herzog Fotografie – vielen Dank!




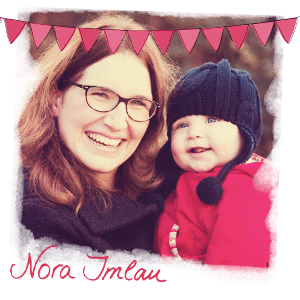

2 Comments on "Brauchen Babys einen Rhythmus?"
Anja
08/05/2018Hallo Nora,
ich versuche meinem Kleinen auch gerade einen Rhythmus anzutrainieren. Aber das funktioniert leider noch nicht so, wie gewünscht. Bisher ist er der Taktgeber und hält mich auf Trab.
Deinen Bericht finde ich toll und ich werde versuchen einiges davon umzusetzen.
Lieben Gruß
Anja
Michaela
05/12/2018Danke für den tollen Artikel! Meine Jungs sind zwar schon 3 und 5, aber den bekommt ab sofort jede werdende Mama in meinem Freundeskreis.